
Drei-Gänge-Menü:
Covid-Dünnpfiff auf Pseudo-Marx à la Vighi mit roher Kriegserklärung Luxemburgischer Art
Mächte des Bösen
Pandemie oder Plandemie?
Real- und Finanzwirtschaft
So oder so: Reichtums- und Machterhalt
Verschwörungs- und Wirtschaftstheorien
Finanzregime durch Arbeitsmangel?
Automatisierung
Goldene Kälber
Konsum Lohnabhängiger
Ende des Kapitalismus
Neue Weltordnung und Krieg
Ausweg mit kollektivistischem und individualistischem Rand
Verschwörungs- und Wirtschaftstheorien
Dem Denkverbot, das der Begriff der Verschwörungstheorie denen auferlegt, die auf ihn hereinfallen, entspricht auf der Gegenseite eine – nicht immer – weniger schlimme Denkblockade:
Gesellschaftliche oder sozioökonomische Entwicklungen, die der als verantwortlich zusammengestellten Gruppe Vorteile bringen, werden allein deshalb schon als von ihr willentlich herbeigeführt angesehen. Daraus entsteht der Eindruck, die Gruppe sei zu langfristigen Planungen befähigt. Nach anderen Erklärungen wird nur dann gesucht, wenn Entwicklungen der verantwortlich gemachten Gruppe Nachteile bringen und daher von ihr nicht beabsichtigt gewesen sein könnten.
Diese Denkblockade kann sich, wie oben angedeutet, dahingehend auswirken, dass der verantwortlich gemachten Gruppe ohne genauere Untersuchung unterstellt wird, Nutzen aus etwas zu ziehen, das ihr vielleicht gar nichts nützt oder nur einem Teil dieser Gruppe zu Lasten eines anderen Teils etwas nützt. Mit der pauschalen Nutzenunterstellung wird vermieden, in Erwägung ziehen zu müssen, dass es eine verantwortliche Gruppe im angenommenen Sinn vielleicht gar nicht gibt.
Der wahre Kern der Kritik an Verschwörungstheorien bezieht sich auf das sich selbst bestätigende, zirkuläre Denken, zu dem sie motivieren. Verschwörungstheorien können eine Realitätsferne erzeugen, die den Widerstand gegen diktatorische Entwicklungen schwächt.
Praktisch sicherer ist es meistens, umgekehrt zu verfahren: Erst, wenn sich keine gesellschaftlichen oder sozioökonomischen Erklärungen für eine gesellschaftliche oder sozioökonomische Entwicklung finden oder wenn solche Erklärungen nicht genügen, sollten Verschwörungstheorien erwogen werden – außer, es liegen konkrete Nachweise vor, das heißt Verschwörungsbeobachtungen und nicht bloß ‑theorien beziehungsweise zeitliche Entsprechungen von Geschehnissen, deren Punkte man angeblich nur zu verbinden braucht.
Im Fall einer nachgewiesenen Verschwörung wäre aber ebenfalls nach gesellschaftlichen oder sozioökonomischen Erklärungen dafür zu suchen, weshalb es zu der betreffenden Verschwörung kam und kommen konnte, damit wir Wege finden, um derartige Verschwörungen zukünftig unmöglich zu machen. Denn davon auszugehen, dass Beteiligte an Verschwörungen bösere oder gierigere Individuen sind als Unbeteiligte, so dass sich das Problem mit Auswechslungen von Individuen an entscheidenden Positionen beheben lässt, wäre naiv. Denen, die nicht an Verschwörungen beteiligt sind oder zu ihren Opfern werden, fehlen im Allgemeinen lediglich Möglichkeiten, ihre Bösartigkeit und Gier zum Schaden anderer auszuleben. »Wir« sind nicht besser als »die«, nur machtloser.
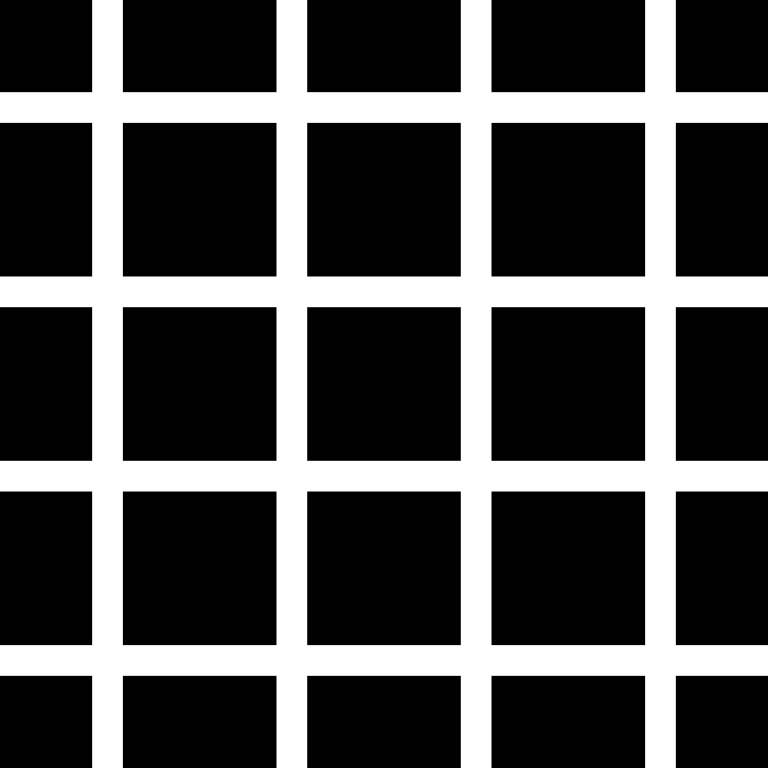
Finanzregime durch Arbeitsmangel?
Es liegt nahe, nicht-verschwörungstheoretisch zu fragen, wie »unsere Finanzherren« dermaßen Macht gewinnen konnten, dass sie absichtlich oder unbeabsichtigt oder gemischt beides, in Hinterzimmerzusammenkünften oder als Effekt teilweise gegensätzlich wirkender gesellschaftlicher Kräftefelder oder gemischt beidem erfolgreich die Errichtung einer weltweiten Diktatur mit Totalüberwachung und Staatszugriff auf alle menschlichen Körper betreiben können.
Sollte die Macht »unserer Finanzherren« nicht aus den Verhältnissen heraus entstanden sein, die Vighi als »produktive Wirtschaft« mit »freiheitlich-demokratischer Infrastruktur« bezeichnet?
Wenn sie nicht aus dem Nichts oder aus der Unterwelt verliehen sein soll und wenn sie auch nicht aus der dann wohl doch nicht so freiheitlich-demokratischen »produktiven Wirtschaft« hervorgegangen sein soll, bleibt nur eines: die Macht »unserer Finanzherren« muss aus dem Untergang der »produktiven Wirtschaft« hervorgegangen sein.
Vighi erklärt dazu:
1. Die Aufgabe der Wirtschaft, Mehrwert zu erwirtschaften, ist sowohl der Antrieb, die Arbeitskräfte auszubeuten, als auch sie aus der Produktion zu verdrängen. Dies ist es, was Marx den »beweglichen Widerspruch« des Kapitalismus [1] nannte, der zwar das Wesen unserer Produktionsweise ausmacht, heute aber nach hinten losgeht und die politische Ökonomie in einen Modus der permanenten Verwüstung verwandelt.
2. Der Grund für diese Wendung des Schicksals ist das objektive Scheitern der Dialektik zwischen Arbeit und Kapital: Die beispiellose Beschleunigung der technologischen Automatisierung seit den 1980er Jahren führt dazu, dass mehr Arbeitskraft aus der Produktion ausgestoßen als (wieder) aufgenommen wird. Die Schrumpfung des Lohnvolumens bedeutet, dass die Kaufkraft eines wachsenden Teils der Weltbevölkerung sinkt, was zwangsläufig zu Verschuldung und Verelendung führt.
3. Da weniger Mehrwert produziert wird, sucht das Kapital nach unmittelbaren Renditen im verschuldeten Finanzsektor statt in der Realwirtschaft oder durch Investitionen in sozial konstruktive Bereiche wie Bildung, Forschung und öffentliche Dienstleistungen.
Unterm Strich ist der sich vollziehende Paradigmenwechsel die notwendige Bedingung für das (dystopische) Überleben des Kapitalismus, der nicht mehr in der Lage ist, sich durch Massenlohnarbeit und die damit verbundene Konsumutopie zu reproduzieren.
Global gesehen gibt es bisher keinen langfristigen Trend zu weniger lohnabhängiger Arbeit. Im Gegenteil: Weltweit stieg die absolute Anzahl der Lohnarbeitenden in den letzten Jahrzehnten um hunderte von Millionen Menschen an, während die Welt-Erwerbslosenrate etwa konstant blieb. Die Kaufkraft eines wachsenden Teils der Weltbevölkerung sank nicht, sondern stieg. In Ländern wie Deutschland, Großbritannien und den USA schrumpften für viele die Realeinkommen, aber in anderen Ländern stiegen die Reallöhne auch in den unteren Lohngruppen.




Automatisierung
Automatisierungswellen der Vergangenheit wie die Elektrifizierung der Industrie oder die »digitale Revoluton« brachten gigantische Umbrüche und hohe Erwerbslosigkeit mit sich, aber senkten bis heute nicht das Gesamtangebot an profitablen Lohnarbeitsplätzen anteilig zur wachsenden Weltbevölkerung.
Zukünftige Automatisierungswellen könnten das Gesamtangebot an profitablen Lohnarbeitsplätzen relativ zur Weltbevölkerung senken, aber – da noch nicht geschehen – die aktuelle Wirtschaftskrise nicht erklären.[2] Ein seriöser Hochrechnungsversuch, dem es nicht um Mitgliederwerbung für Gewerkschaften, nicht um Schlagzeilen und nicht um neoliberale Verharmlosungen geht, schätzt bezogen auf die USA, dass es beginnend ab 2015 bis 2025 zu einer Senkung der Beschäftigung anteilig zur US-Bevölkerung um etwa 1 Prozent kommt, und in den folgenden Jahrzehnten zu schrittweise wachsenden Senkungen.[3]
Würde der Kapitalismus so funktionieren wie Vighi und viele andere meinen (dazu unten), ließen sich in seinem Rahmen weit größere Automatisierungseffekte durch Arbeitszeitverkürzungen abfangen, ohne dass es zu Wohlstandsverlusten kommen müsste.
Dem Eindruck, dem Kapital käme die menschliche Arbeit so weitgehend abhanden, dass es einpacken kann, liegt die Vorstellung begrenzter menschlicher Bedürfnisse von bereits gut Versorgten zugrunde – zusätzlich ein elitäres Vorurteil, industrielle Handarbeit erfordere so wenig Grips und Skill, dass ihre Ersetzung durch Künstliche Intelligenz und Roboter ein Kinderspiel ist. Im Transportwesen, bei Lehrpersonal und Schulmedizinerinnen mag das so sein. Auf der anderen Seite steht insbesondere der größere Teil Afrikas erst am Beginn der Industrialisierung. Dort gibt’s noch enorm viel Hand- und Kopfarbeit zu tun, bis alle gut ernährt sind und fließend Wasser und Strom in Wohnungen mit Badezimmern haben – und noch mehr Hand- und Kopfarbeit weltweit, wenn dies umweltverträglich geschehen soll.
Dem Konsumbedürfnis und der Bereitschaft zum Wegwerfen immer schneller veraltender Dinge wie auch dem Bedarf nach Dienstleistungen aller Art und arbeitsintensiv »biologisch« hergestelltem Kram sind keine Grenzen gesetzt. Sobald die Automatisierung eine Warenart für die breite Masse erschwinglich gemacht hat, wird schon ein nächster Wunsch erzeugt, den zu erfüllen menschliche Arbeit erfordert. Sobald »Grenzen der Natur« und »Tierliebe« wirksam werden, entsteht zusätzlicher Arbeitsaufwand.
Im Kapitalismus wird menschliche Arbeit meist nur wegrationalisiert, wenn die Automatisierungskosten niedriger liegen als die Arbeitskosten, die ohne Automatisierung in einem gewissen Zeitfenster voraussichtlich anfallen würden. Je rasanter die technologische Entwicklung, desto kleiner ist das Zeitfenster. An Automaten, die in 5 Jahren veraltet sind, ist das Kapital wenig interessiert, wenn durch sie Arbeitskosten eingespart werden, die voraussichtlich 6 Jahre brauchen, um anzufallen. Niedrige Löhne hemmen die Automatisierung. Hohe Löhne fördern sie, aber dann auch wieder die Erwerbslosigkeit, wodurch die Löhne sinken. Eine hohe Erwerbslosigkeit fördert die Ausbreitung wenig automatisierter Sweatshops und Dienstleistungsunternehmen mit niedrigen Löhnen und Profiten. Ist die Entwicklung der nächsten Jahre schlecht absehbar, wird oft trotz Kostenvorteilen nicht automatisiert.
Die Auswirkungen der Automatisierung auf den Mehrwert und die Profitrate sind ähnlich unsimpel.
Mehrwert entsteht nach Marx durch Arbeit, die Lohnabhängige über die Arbeit hinaus leisten, die der Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft dient. Zur Wiederherstellung der Arbeitskraft erforderliche Arbeiten umfassen die Herstellung von Lebensmitteln im weitesten Sinn oder von Waren, die gegen Lebensmittel gehandelt werden können. Darüber hinaus umfassen sie den Bau von Wohnhäusern und den Betrieb von Schulen, die Versorgung von Medizinerinnen, die Produktion von Propaganda zur Vorbeugung von Revolutionen und anderes mehr.
Mit zunehmender Automatisierung schrumpft zunächst der Anteil der zur Wiederherstellung der Arbeitskraft notwendigen Arbeit an der Gesamtarbeit: Schuhe, T‑Shirts, Pizzas, Einwegspritzen und weiße Kittel, Bücher, TV-Seifenopern … lassen sich mit weniger Arbeit herstellen. Entsprechend mehr Arbeitszeit können die Lohnabhängigen für Kapitalistinnen zur unbezahlten Aneignung erübrigen. In den Worten von Marx: die Mehrwertrate steigt.
Automatisierung senkt tendenziell die Profitrate, ohne dass der Anteil der unbezahlt angeeigneten Arbeit an der Gesamtarbeit zu sinken bräuchte.
Kapitalistinnen können sich Arbeit ihrer Lohnabhängigen unbezahlt aneignen, indem sie Löhne zahlen, die insgesamt niedriger liegen als dem Wert entspricht, den die Lohnabhängigen erzeugen. Das geht einfach – zumal an der Oberfläche nichts von »Ausbeutung« zu bemerken ist: Kapitalistinnen machen Profite, indem sie die Verkaufspreise höher setzen als ihre Produktionskosten betragen. Wäre das alles, dann wäre »Profit« nur ein anderes Wort für »Preisinflation«. Erst dadurch, dass der Preisaufschlag Arbeit repräsentiert, kann er mehr als heiße Luft sein.
Was passiert bei Automatisierungen? Anstatt sich die Arbeit ihrer Lohnabhängigen anzueigen, kaufen Kapitalistinnen von anderen Kapitalistinnen Produktionsmittel (Automaten, Maschinen). Erst die Kapitalistinnen der Produktionsmitteindustrie können sich Arbeit ihrer Lohnabhängigen unbezahlt aneignen, indem sie Löhne zahlen, die insgesamt niedriger liegen als dem Wert entspricht, den die Lohnabhängigen erzeugen. Kapitalistinnen der Produktionsmitteindustrie möchten beim Verkauf der Produktionsmittel die Arbeit ihrer Lohnabhängigen, die sie sich unbezahlt angeeignet haben, in Geld umwandeln. Sie möchten Profite machen, den »Mehrwert realisieren«. Beim Kauf von Produktionsmitteln bezahlen die kaufenden Kapitalistinnen die Arbeit, die sich die verkaufenden Kapitalistinnen unbezahlt angeeignet haben.
Auf das Gesamtkapital bezogen sinkt daher mit zunehmender Automatisierung der Anteil unbezahlt bleibender Arbeit an der Gesamtarbeit. Dadurch sinkt auf das Gesamtkapital bezogen die Profitrate.
Profit entsteht aus der unmittelbaren Aneignung der Arbeit Lohnabhängiger, aus der Ausbeutung »lebendiger Arbeit«, wie es bei Marx heißt. Aus gegenseitigen Verkäufen von Waren, in denen unbezahlt angeeignete Arbeit vergegenständlicht ist, aus »toter Arbeit«, kann das Gesamtkapital keinen Profit ziehen, wenn die Kapitalistinnen einander gegenseitig die unbezahlt angeeignete Arbeit bezahlen. Marx schreibt dazu:
Da die Masse der angewandten lebendigen Arbeit stets abnimmt im Verhältnis zu der Masse der von ihr in Bewegung gesetzten vergegenständlichten Arbeit, der produktiv konsumierten Produktionsmittel, so muss auch der Teil dieser lebendigen Arbeit, der unbezahlt ist und sich in Mehrwert vergegenständlicht, in einem stets abnehmenden Verhältnis stehn zum Wertumfang des angewandten Gesamtkapitals. Dies Verhältnis der Mehrwertsmasse zum Wert des angewandten Gesamtkapitals bildet aber die Profitrate, die daher beständig fallen muss. (Das Kapital III, S. 223)
Hier fasst Marx nur jenen Teil der von Einzelkapitalen unbezahlt angeeigneten Arbeit als »Mehrwert« auf, der bezogen auf das Gesamtkapital unbezahlt bleibt. Arbeit, die der Herstellung von Produktionsmitteln dient, erzeugt Mehrwert für die herstellenden Kapitalistinnen. Indem diese Kapitalistinnen die Produktionsmittel an andere Kapitalistinnen verkaufen, machen sie Profit. Da dieser Profit aber einen Kostenfaktor für die anderen Kapitalistinnen darstellt, entsteht für das Gesamtkapital kein Profit.
Für die Profitrate des Gesamtkapitals spielen weder die Gesamtmasse der unbezahlt angeeigneten Arbeit beziehungsweise Durchschnittsarbeitsstunden noch die Gesamtmasse des erzeugten Werts eine Rolle. Gäbe es auf der ganzen Welt nur eine einzige Arbeiterin, die in einer 20-Stunden-Woche sämtliche Roboter herstellen könnte, die die ganze Menschheit mit sämtlichen Dingen versorgen, die sie haben möchten, so würde diese Arbeiterin ihre Kapitalistin mit einer Profitrate von nahezu 100 Prozent beglücken, denn die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft würde einen verschwindend kleinen Teil ihrer Wochenarbeitszeit erfordern.
Entscheidend für die Profitrate des Gesamtkapitals ist das Verhältnis zwischen der bezogen auf das Gesamtkapital unbezahlt angeeigneten Arbeit zur bezahlten Arbeit. Innerhalb eines kapitalistischen Systems sorgen gewisse Mechanismen dafür, dass Branchen mit einem hohen Anteil lebendiger Arbeit nicht schon deshalb höheren Profit machen. Es kommt zu einem Ausgleich der Profitraten, so dass die Profitraten der Einzelkapitale um die Profitrate des Gesamtkapitals schwanken.
Unter die Profitabilität fallende Profitraten und in deren Folge Finanzmarktaufblähungen sind typisch für Wirtschaftskrisen. Erfahrungsgemäß steigen die Profitraten wieder in den Profitabilitätsbereich, nachdem die Finanzmärkte zusammengekracht und weitere Schrecklichkeiten passiert sind. Langfristig, über Konjunkturzyklen hinweg, sinkt laut Marx die Profitrate. Das braucht aber nicht zu bedeuten, dass der Kapitalismus an einer zu niedrigen Profitrate zu Grunde gehen müsste. Denn »die Masse der angewandten lebendigen Arbeit … im Verhältnis zu der Masse der … vergegenständlichten Arbeit« ist keine unveränderliche Gottesgegebenheit. So zeichnet sich ab, dass zukünftige Arbeiterinnen in Folge der »Covid-Maßnahmen« einer ständigen persönlichen psychotherapeutischen Begleitung bedürfen werden. Damit wäre »die Masse der angewandten lebendigen Arbeit … im Verhältnis zu der Masse der … vergegenständlichten Arbeit« schlagartig mindestens verdoppelt. Im Ernst: Würde der Kapitalismus so funktionieren wie Vighi und viele andere meinen (dazu unten mehr), ließe sich das Problem der tendenziell sinkenden Profitrate durch Ausbau und Neuerschaffung arbeitsintensiver Wirtschaftszweige, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, lösen.
Soweit es die Menge der profitabel ausbeutbaren Arbeit betrifft, ist eine ruckartige langfristige Entwicklung im Gange, nicht eine Entwicklung, die der kapitalistischen Profitabilität hier und heute oder in den kommenden Jahrzehnten den Garaus machen würde, aber eine, deren Ende nicht mehr nur für Extremweitsichtige wie Marx in Sichtweite liegt. Dieser meinte in einer Zeit ohne Trecker und Computer, von Robotern ganz zu schweigen:
Die Entwicklung der Industrie, im Verlauf derer »der Arbeiter […] neben den Produktionsprozeß [tritt], statt sein Hauptagent zu sein«, ist »die letzte Entwicklung […] der auf dem Wert beruhenden Produktion. […] Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein […]. Die freie Entwicklung der Individualitäten und daher nicht das Reduzieren der notwendigen Arbeitszeit, um Surplusarbeit [unbezahlt angeeignete Arbeit] zu setzen, sondern überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle freigewordne Zeit und geschaffnen Mittel entspricht.« (Marx: Grundrisse)
Wenn es soweit ist, wird Geld wie beim Raumschiff Enterprise eine ulkige Erscheinung der Vergangenheit sein.
Goldene Kälber
Solange Wert, Arbeit, Kapitalismus und Geld noch eine Rolle spielen, kann die Covid-»Impf«-Aktion dem Gesamtkapital keinen Profit bringen. Sie bringt eine Zunahme der Arbeit mit sich, die zur Reproduktion der Arbeitskräfte nötig ist, und verringert damit die Mehrwertrate. Der Profit der Pharmakonzerne wird letztlich von anderen Kapitalistinnen bezahlt.
Wer an die »Impfungen« glaubt, kann sie trotzdem kapitalistisch erklären: als zweckmäßigen Beitrag zur Reproduktion der Arbeitskräfte, ohne den ein allzu hoher Krankenstand und viele Todesfälle höhere Profiteinbuße brächten. Wer nicht an die »Impfungen« glaubt, kann sie nicht als kapitalistisch zweckmäßig erklären und muss auf den Gedanken der Korruption zum Schaden des Gesamtkapitals oder den der Verschwörung zurückgreifen.
Wieder anders sieht die Welt aus, wenn man Geld mit Wert identifiziert.
Laut Vighi sind »die Impfstoffe das goldene Kalb des dritten Jahrtausends«.
Können »die Impfstoffe« ein »goldenes Kalb« sein, so sind lediglich Verbeugungen und Opferungen nötig, um Gold zu erzeugen:
Die potenziell endlose Nachfrage nach Impfstoffen und experimentellen Genpräparaten bietet den Pharmakartellen die Aussicht auf nahezu unbegrenzte Gewinnströme, insbesondere wenn sie durch Massenimpfprogramme garantiert werden, die mit öffentlichen Geldern subventioniert werden (das heißt durch weitere Schulden, die uns auf den Kopf fallen werden).
Wie werden »Schulden« zu »Gewinnströmen«, die bis zum Ende des Jahrtausends fließen, während die Massen immer weniger Arbeit zu tun finden, die eine Schuldenrückzahlung mit Geld, das Wert repräsentieren könnte, ermöglichen würde?
Sollten sich »die Eliten« mit der Durchfütterung erwerbslos gewordener, das Klima schädigender Menschen belasten wollen, weil es ohne sie weniger Dosen zu verimpfen gäbe und die »Gewinnströme« entsprechend ausgedünnt wären?
Wenn »die Impfstoffe« ein »goldenes Kalb« sein können, dann kann im Prinzip jede beliebige andere Sache, die den Lohnabhängigen Freude statt Schmerzen schenkt und ihnen nicht durch Dauerpropaganda angedreht oder durch staatliche Drohungen aufgezwungen werden muss, ein »goldenes Kalb« sein.
Zwischen betreutem Zwangsblumenpflanzen und Zwangsimpfung besteht kaum ein ökonomischer Unterschied. Wahrscheinlich entsprechen die Produktionskosten pro Impfdosis denen einer Primel.
Zur Erklärung, weshalb »die Eliten« gerade »die Impfstoffe« als ihr »goldenes Kalb« auswählen und nicht etwas Schöneres aus »sozial konstruktiven Bereichen«, bleibt damit nichts anderes als Korruption oder Verschwörung. – Es sei denn, man sieht das gegenwärtige Problem des Kapitalismus im Aussterben der profitabel ausbeutbaren menschlichen Arbeit. Dann könnte man meinen, das Interesse, das »die Eliten« mit der Covid-»Impf«-Aktion verfolgen, ziele quasi systembedingt auf Bevölkerungsreduktion. Utopisch wäre dieses Ziel nicht. Seit »Impf«-Beginn haben Bevölkerungsmehrheiten vieler Länder bewiesen, dass sie verdummt genug sind, um ihre Ausrottung nicht zu bemerken, wenn diese nur langsam genug geschieht und mit etwas Propaganda kaschiert wird. Weniger naheliegen würde dieses Ziel nur, wenn man mit Vighi goldene Kälber anbetet.
Konsum Lohnabhängiger
Nach Vighis Vorstellung, die viele teilen, konnte sich der Kapitalismus bisher »durch Massenlohnarbeit und die damit verbundene Konsumutopie […] reproduzieren.«
Wer Massen-»Impfungen« für goldene Kälber hält, aber nicht glaubt, dass sich Wirtschaftssysteme durch Utopien reproduzieren, kann dafür setzen:
Bisher konnte sich der Kapitalismus durch Massenlohnarbeit und den damit verbundenen Konsum reproduzieren.
Trifft diese Vorstellung zu, gibt es keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital. Der Staat wäre als Wahrer des Kapitalismus, als ideeller Gesamtkapitalist, an ordentlichen Löhnen interessiert, damit der Kapitalismus gedeiht. Sogar die einzelnen Kapitalistinnen müssten vernünftigerweise für einen ordentlichen Mindestlohn eintreten, damit sie sich im Konkurrenzkampf nicht letztlich selbst auf’s Kreuz legen.
Ein Kapitalismus, der sich durch Massenlohnarbeit und damit verbundenem Konsum reproduzieren kann, wäre auf der politischen Ebene zur Zufriedenheit sowohl der Kapitalistinnen als auch der Lohnarbeitenden reformierbar – und er wäre im Wesentlichen friedlich.
Um solch einen Kapitalismus als dem Untergang geweiht auffassen zu können, bleibt kaum anderes übrig, als die Welt untergehen oder die menschliche Arbeit aussterben zu lassen.
Da sich viele Kritikerinnen der gegenwärtigen Diktaturentwicklung nicht vorstellen können, dass der Kapitalismus sich nicht durch Massenlohnarbeit und damit verbundenem Konsum reproduzieren könnte, neigen viele zu Verschwörungstheorien, linke wie rechte. Denn außer durch die Machenschaften böser gieriger Menschen lassen sich dann weder Kolonialismus und Kriege noch »die Impfungen« noch die Weigerung erklären, das System soweit angenehm zu gestalten, dass zur Reichtums- und Machtsicherung »der Eliten« keine Diktatur nötig ist. Bei aussterbender Arbeit liegt insbesondere kein Grund vor, die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht nach und nach auf eine Minute zu begrenzen. Künstliche Intelligenz würde mit feingliedrig-sensibler Apparatur umweltfreundlich das Nötige erledigen, so dass niemand darben müsste. Unterdessen könnten sich »die Eliten« in ihren Swimmingpools suhlen, vielleicht zur Befriedigung ihrer speziellen Bedürfnisse die Künstliche Intelligenz echt wirkende Dämonen und Androidkinder entwickeln lassen.
In diese Richtung etwa könnte sich Klaus Schwabs »Stakeholderkapitalismus« entwickeln. Seine Vorstellungen von der Funktionsweise des Kapitalismus entsprechen denen der UNO Agenda 2030 und unterscheiden sich nicht grundlegend von denen Vighis, Lenins und der SPD. Im Glauben an einen Kapitalismus, der sich durch Massenlohnarbeit und damit verbundenem Konsum reproduziert, eignen sich Schwab und die UNO nur zu Feinden, indem man ihnen Bosheit und Lügnerei unterstellt.
Verweise
[1] Der Ausdruck »beweglicher Widerspruch« ist eine direkte Übersetzung von »moving contradiction«. Vighi verweist auf die englische Ausgabe der Grundrisse von Karl Marx. In der deutschen heißt es: »Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt.«
[2] Siehe zum Beispiel European Parliamentary Research Service: Digital automation and the future of work. PE 656.311 – January 2021,S. 23f (In der Studie wird vermerkt, dass Roboter bei Amazon die Qualität des Arbeitens verschlechtern, indem sie die Arbeitenden dazu nötigen, wie Roboter zu arbeiten.)
[3] Daron Acemoglu, Pascual Restrepo: Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. Journal of Political Economy, 2020, vol. 128, no. 6, im PDF S. 54


