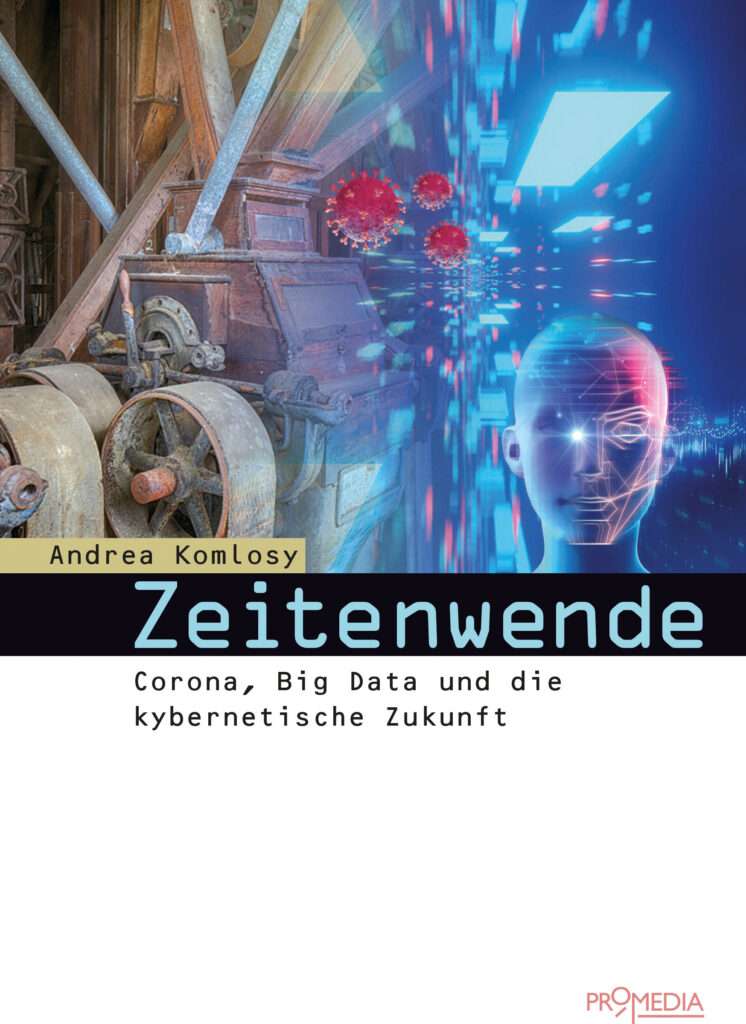
Andrea Komlosys Buch Zeitenwende gehört zu den sehr wenigen Texten von Sozialwissenschaftlern, die sich kritisch mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen beschäftigt haben. Die Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosy, geboren 1957, ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Ihr Buch ist im relativ eingeführten Promedia-Verlag erscheinen. Glücklicherweise war sie also von dem Blackout nicht betroffen, der über coronakritische Wissenschaftler wie Kees van der Pijl und investigative Journalisten wie Thomas Röper verhängt wurde.
Komlosy vertritt in ihrem Buch einen strukturgeschichtlichen Ansatz zur Erklärung der Corona-Pandemie: »Weder geriet alles durcheinander noch wird ein großer Plan in die Tat umgesetzt.«1 Vielmehr versucht sie, diese Pandemie und ihre Folgen in langfristige Trends und Zyklen einzuordnen:
Corona wurde von vielerlei Seiten als ›Zeitenwende‹ gesehen: Eine Gelegenheit, ein Opportunitätsfenster, eine einmalige Chance, alte Strukturen aufzubrechen und Reformmüdigkeit zu überwinden. PolitikerInnen, TechnikerInnen, VertreterInnen aufstrebender Branchen und ZukunftsforscherInnen überschlugen sich geradezu vor Begeisterung über die Nachfrage- und Wachstumspotenziale, die Corona eröffnete. Aber auch wachstumskritische Kreise applaudierten den Lockdowns, weil sie Perspektiven für einen ökosozialen Umbau eröffneten.2
Distanzgebote wirken ihrer Ansicht nach als Schubkraft für digitale Kommunikation, Online-Handel und Home Office, das Herunterfahren der Wirtschaft durch verordnete Schließungen begünstigt ihren Umbau auf neue, aufstrebende Geschäftsfelder (»international«, »digital«, »smart«, »grün«), das Tracking des Gesundheitszustandes und die Nachverfolgung der persönlichen Bewegungsmuster dienen als Schubkraft für digitale Überwachung, was sowohl im staatlichen (Big Brother) wie auch im ökonomischen Interesse sei (Big Data und Big Profit).3
Massenkonsum und Massenproduktion waren typisch für die Industriegesellschaft. In der neuen kybernetischen Gesellschaft sind die Waren auf einzelne Zielpersonen zugeschnitten. Diese verheißen die Selbstoptimierung bis hin zur eigenen Vervollkommnung als unsterbliches Wesen, so die Autorin.4
Das Corona-Moment fungiere als Katalysator für diese Entwicklung, die Komlosy wohl für irreversibel hält. Das Herunterfahren der sozialen Kontakte und der Wirtschaft habe einen Boom für neue Bereiche der IT-Industrie bewirkt, die sich allesamt um Digitalisierung, Robotik, Mensch-Maschine-Verbindungen und Künstliche Intelligenz drehen. Aber auch die so genannten MANBRIC-Technologien (Medical, additive, nano‑, bio‑, robo‑, info‑, and cogno-technologies) werden ihrer Meinung nach einen großen Aufschwung nehmen. Die Corona-»Impfungen« seien nur der Anfang.
Der jetzt anstehende Übergang von der Industriegesellschaft hin zu einer kybernetischen Gesellschaft ist nach Komlosy nur vergleichbar ist mit dem Übergang der altsteinzeitlichen Jäger- und Sammlergesellschaften zur Agrargesellschaft und von ihr zur Industriegesellschaft.
Hier referiert sie zustimmend Klaus Schwab und Yuval Noah Harari, die beide davon ausgehen, dass Kybernetik, Künstliche Intelligenz und Biotechnologie ein neues Zeitalter herbeiführen werden. Der Homo sapiens sei obsolet geworden und entwickelt sich weiter zum Homo deus, so Harari. Damit drohen allerdings auch Gefahren:
Mit Maschinenintelligenz ausgestattet, könnte eine Super-Elite die Herrschaft übernehmen, mithilfe technischer Möglichkeiten Körper, Gehirn und Bewusstseinszustand optimieren und die Masse der Menschheit zur Nutz- und Bedeutungslosigkeit verurteilen.5
Die Autorin bettet diesen Übergang ein in die Theorie der langen Wellen. Danach gibt es im Kapitalismus nicht nur kurzfristige Konjunkturzyklen, sondern ungefähr 25-jährige Perioden einer allgemein expansiven Wirtschaftsentwicklung (A‑Phase), gefolgt von gleichlangen Abschwungsperioden (B‑Phase). Die letzte expansive Phase dauerte von 1989 bis 2008; wir befinden uns jetzt in einer B‑Phase. Obwohl Komlosy Ernest Mandel als Theoretiker der Langen Wellen zumindest erwähnt, referiert sie in der Folge nur die ältere Theorie von Kondratiew. Für Mandel ist das Auf- und Ab der Profitrate die primäre Ursache für das Umschlagen einer langen Welle mit depressiver in eine solche mit expansiver Tendenz und umgekehrt. Eine stark ansteigende Profitrate bewirkt dann die Anlage von bisher brachliegendem Kapital, die Nutzung von neuen naturwissenschaftlichen Entdeckungen und damit die Verbreitung von neuen Technologien.
Auslöser für eine lange Welle mit expansivem Charakter waren nach Mandel immer geographische, geologische und politische Faktoren. Diese waren spezifisch und es ist keineswegs garantiert, dass noch einmal so viele Faktoren zusammenkommen, um eine neue lange Welle mit expansiver Tendenz auszulösen. Der Umschlag in eine lange Welle mit stagnierender Tendenz wird dagegen gesetzmäßig durch die im Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate beschriebene Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals hervorgerufen.
Für Kondratiew dagegen bewirken neue neuen Technologien einen Anstieg der Profitrate und damit eine langanhaltende Aufschwungsperiode. Da Komlosy nur seine Ansichten darstellt, scheint sie sich diese zu eigen gemacht zu haben.
Sie erkennt, dass die menschliche Arbeitskraft immer stärker durch Maschinen ersetzt wird und dadurch die vom Kapital angeeignete Mehrarbeit zurückgeht (tendenzieller Fall der Profitrate). Insofern argumentiert sie marxistisch. Allerdings scheint sie zu glauben, dass dieser Rückgang durch die Aneignung von menschlicher Erfahrung in Form von Daten durch den Plattformkapitalismus ausgeglichen werden kann: »Wir können also von einer Verschiebung im Aneignungsmodus sprechen, die die Aneignung der Erfahrung gegenüber der Ausbeutung der Arbeitskraft in den Vordergrund treten lässt.«6
Komlosy definiert Daten unter Verweis auf Shoshana Zuboff als den neuen Rohstoff des Überwachungskapitalismus. Diese würden die bisherigen drei Bereiche ergänzen, die im Kapitalismus der Marktdynamik unterworfen wurden: Natur verwandelt sich in Grundbesitz, Leben in Arbeitskraft und Austausch in Geld. Letztlich geht diese These über mehrere Stationen auf den siebten und letzten Abschnitt des dritten Bandes des Kapitals von Karl Marx zurück, der überschrieben ist mit »Die Revenuen und ihre Quellen«.
Für Marx handelt es sich dabei allerdings um Mystifikationen des bürgerlichen Bewusstseins, wenn er schreibt:
Im Kapital – Profit, oder noch besser Kapital – Zins, Boden – Grundrente, Arbeit – Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben.7
Bereits die klassische politische Ökonomie hat nach Marx diese Mystifikationen aufgelöst, indem sie zeigte, dass Zins ein Teil des Profits und die Grundrente auf den Überschuss über dem Durchschnittsprofit zurückgeführt werden kann, sie also im Mehrwert zusammenfallen, der ja nur durch menschliche Arbeitskraft geschaffen werden kann.8
Marx ging bekanntlich davon aus, dass nur die Ware Arbeitskraft Wert und Mehrwert produzieren kann. Aus marxistischer Sicht besitzen auch Daten von sich aus keinen Wert. Sie werden an Werbetreibende verkauft und haben für diese letztlich nur dann Wert, wenn ihre Nutzung zum Beispiel in der personalisierten Werbung sich durch entsprechende Käufe bezahlt macht. Je stärker die Menschen aber verarmen – aus welchem Grund auch immer – desto geringer ist auch der Wert dieser Daten. Bestenfalls bewirken sie im Rahmen eines Nullsummenspiels eine Umverteilung von Mehrwert etwa von lokalen Geschäften mit sozial einigermaßen abgesicherten Arbeitskräften hin zu Netzwerkfirmen mit Arbeitern ohne jede soziale Absicherung.
Auch die Nutzung von Daten kann aus marxistischer Sicht von sich aus nicht zu einem neuen kapitalistischen Aufschwung führen. Damit hängt Komlosys zentrales Argument, warum ein solcher Aufschwung wahrscheinlich und sogar unvermeidlich ist, in der Luft.
Ein weiteres Problem ihrer These besteht darin, dass sie den technologischen Determinismus der Kondratiewschen Version der Langen-Wellen-Theorie übernimmt.
Zusammengenommen bewirken diese beiden problematischen theoretischen Festlegungen einen nach Ansicht des Rezensenten nicht gerechtfertigten Optimismus dahingehend, dass die Verheißungen der Oligarchen um Schwab und das World Economic Forum zur Wirklichkeit werden. Denn ob diese schöne, neue Welt utopische oder dystopische Züge annimmt, ist Komlosys Meinung nach noch nicht entschieden. Sie plädiert wohl dafür, diese Entwicklung kritisch zu begleiten und sie mitzugestalten, was voraussetzt, dass man sich auf sie einlässt. Denn, so Komlosy:
Es ist auch nicht ratsam, die Versprechungen auf ein leichteres, längeres Leben und ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Wirtschaften, die der jungen Generation eingeimpft werden, einfach wegzuwischen.9
Oder an dieser Stelle noch deutlicher: »Die Ablöse des industriellen durch das kybernetische Prinzip scheint unausweichlich. Wir befinden uns mitten im Umbruch.«10
Massenproduktion, Massenkonsum, politische Demokratie und gesellschaftlicher Wohlstand neigten sich ihrem Ende zu. Letztendlich sei dieses Ende auch unvermeidlich, da dieser Wohlstand durch Ausbeutung der Natur, der Hausfrauen und der Menschen der Entwicklungsländer erkauft worden sei.
Diese Entwicklung habe aber auch etwas Gutes, führt Komlosy aus:
Bei aller Unsicherheit und Zukunftsangst kann dies als Moment ungeahnter Gestaltungsmöglichkeit begriffen werden. Unterschiedliche Akteure bringen sich in Stellung, um ihren konkurrierenden Visionen und Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Die treibenden Kräfte sind die Advokaten eines erneuerten digitalen postindustriellen Kapitalismus. […] Die Vertreter des Erneuerungskapitalismus versprechen eine ‚schöne neue Welt‘. Dabei wollen sie nicht nur mit dem Industrialismus Schluss machen, sondern auch mit der bürgerlichen Demokratie, der politischen Mitbestimmung, der staatlichen Umverteilung und der internationalen Ordnung der Staaten.11
Sie setzten dagegen auf Optimierung sämtlicher Prozesse durch Big Data und Künstliche Intelligenz:
Wer die Welt des digitalen Kapitalismus nicht verinnerlicht hat, mag sich abgestoßen fühlen. Wer das analoge Leben mit seinen unkontrollierbaren Freiräumen, Selbstverantwortung, Vertrauen und Verbindlichkeit zu schätzen weiß, traut den Versprechungen von Individualisierung, Flexibilisierung, Optimierung und Freiheitsgewinn durch digitale Allgegenwart der Datenspuren nicht. Menschen, die als Digital Natives und Digital Nomads überall und gleichzeitig nirgends auf der Welt zu Hause sind, nehmen die Digitalisierung für gegeben hin wie die Generationen vor ihnen beispielsweise den Takt der Maschine, den wir uns über die Uhr vergegenwärtigen können. Wir haben vergessen, dass dieser Takt der Maschine uns in Zeit- und Bewegungskoordination, in die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, in Pünktlichkeit und Ordnung des Tagesablaufs eingewiesen hat.12
Komlosy vergisst allerdings, dass diese Durchsetzung des Taktes der Maschine äußerst gewaltsam verlief, mehrere Generationen dauerte und mit der Arbeiterbewegung eine Gegenbewegung hervorbrachte, die zu bestimmten Zeiten nahe dran war, den Kapitalismus als Produktionsweise zu überwinden.
Sie hat in ihrem Buch selbst beschrieben, dass sich die Arbeitsverhältnisse gerade der digitalen Nomaden über Homeoffice, Werkverträge und Crowd Working immer weiter verschlechtern bis schließlich nicht mehr genügend Lohn zum Überleben bleibt. Was kann der gegenwärtige Kapitalismus den Menschen überhaupt noch anbieten außer geisttötender Propaganda, Drohungen und totaler Verelendung?
Die Kapitalisten fühlen sich gegenwärtig so sicher, dass sie an Konzessionen nicht im Geringsten denken. Sie ziehen trotz Krieg Sozialabbau (zum Beispiel Rentenreform in Frankreich, Abschaffung der Grundsicherung in Italien), die Zerstörung der Landwirtschaft in den Niederlanden, die Abschaffung der individuellen Mobilität und die Zwangsstillegung großer Teile des in Generationen aufgebauten Wohnraums für die Massen in der gesamten EU eiskalt durch. Unter diesen Umständen hängen nach Ansicht des Rezensenten auch Vorstellungen von einer Mitgestaltung der »schönen neuen Welt« der Oligarchen in der Luft. Die Realität der letzten Jahre zeigt eher, dass sich hinter dem Schwabschen Wortgeklingel tatsächlich dystopische Absichten verbergen.
Diese Kritik bedeutet nun nicht, dass das Buch Zeitenwende nicht auch mit Gewinn gelesen werden kann. Komlosy beschreibt nämlich sehr ausführlich und anhand von zahlreichen Quellen die ökonomischen Veränderungen, die durch das Corona-Moment ausgelöst wurden. Eine solche Untersuchung hat es bisher noch nicht gegeben. Sie kann auch dann zum Verständnis des Great Reset beitragen, wenn man die optimistischen Zukunftsvorstellungen der Autorin nicht zu teilen vermag.
Andrea Komlosy: Zeitenwende. Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Promedia-Verlag, Wien 2022. 288 Seiten, ISBN: 978 – 3‑85371 – 505‑5 (Print), ISBN: 978 – 3‑85371 – 901‑5 (E‑Book), https://mediashop.at/buecher/zeitenwende/
Verweise
1 Andrea Komlosy: Zeitenwende, Wien 2022, E‑Book, Einleitung
2 Komlosy, a.a.O., Einleitung
3 Vgl. Komlosy, a.a.O., Einleitung
4 Vgl. Komlosy, a.a.O., Einleitung
5 Komlosy, a.a.O., Kapitel 1.3: Evolutionszyklen, Unterkapitel: Cyberoptimismus
6 Komlosy, a.a.O., Kapitel 2.2.: Der neue Mensch, Unterkapitel: Verdatung, Unterkapitel: Von der Ausbeutung der Arbeitskraft zur Aneignung der Erfahrung
7 Karl Marx: Das Kapital, Band 3, MEW 25, Berlin 1988, S. 838
8 Vgl. Karl Marx: Das Kapital, Band 3, MEW 25, Berlin 1988, S. 838
9 Komlosy, a.a.O., Kapitel 2.1: Kybernetischer Kapitalismus
10 Komlosy, a.a.O., Schluss
11 Komlosy, a.a.O., Schluss
12 Komlosy, a.a.O., Schluss
Bild: Buchcover Komlosy Zeitenwende, Promedia Verlag


