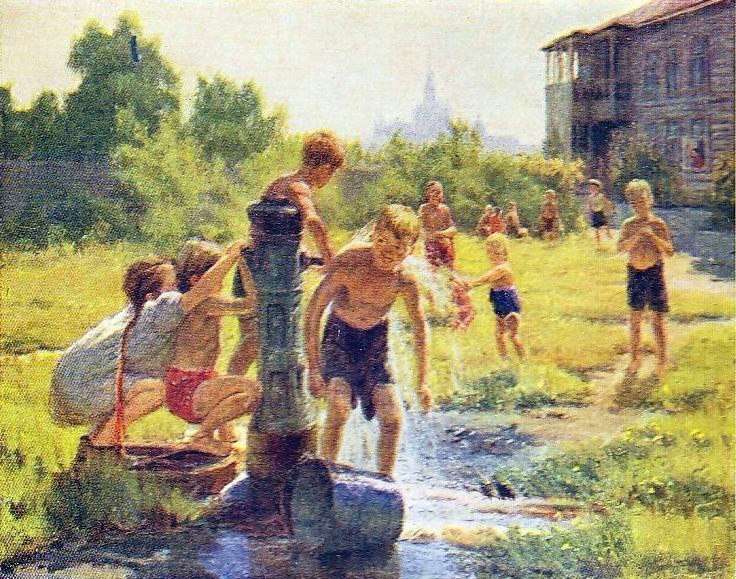
»Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache.«Sherlock Holmes
II: Temperaturentwicklung der letzten 1000 – 2000 beziehungsweise 30 Jahre
III: Temperaturentwicklung der letzten 1000 – 2000 beziehungsweise 3 Jahre
IV: Geschwindigkeit, Gleichzeitigkeit und Mitteltemperatur
V: Zur Entstehungsgeschichte globaler Temperaturkurven
VI: Paris, Temperaturanomalien und ‑mittelungen, Wetterballons und unsere Atmosphäre
VII: Luft- und Wassertemperaturen im Pariser Eintopf
VIII: Nettotreibhausgasemissionsverringerung auf Kapitalistisch
IX: Erhöht CO2 die Temperatur?
VI: Paris, Temperaturanomalien und ‑mittelungen, Wetterballons und unsere Atmosphäre
Die letzte Folge endete mit der Pi-Mal-Auge-Feststellung eines nur geringen Unterschieds zwischen den Globaltemperaturkurven der Datensätze HadCRUT, NOAA Global Temp, GISTEMP und BEST. Diese Feststellung war zu oberflächlich.
GloSAT, eine Forschungsorganisation, die vom britischen Natural Environment Research Council (siehe letzte Folge) finanziert wird, weist auf die wirtschaftlichen Folgen der kleinen Unterschiede hin:
[D]ie vorhandenen Temperatur-Datensätze sind bezüglich des Ausmaßes der bisherigen Erwärmung uneinheitlich. Diese Unstimmigkeit bedeutet eine Unsicherheit von mehr als 20 Prozent in der zulässigen Kohlenstoffbilanz, um die Ziele des Pariser Übereinkommens zu erreichen, allein aufgrund der Unsicherheit in der beobachteten Veränderung der Oberflächentemperatur.1
Das Pariser Übereinkommen ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag von 2015, dem bis heute fast alle Nationalparlamente beziehungsweise Führungsgremien der Welt zustimmten. Das Übereinkommen will den Anstieg der globalen mittleren Oberflächentemperatur (GMST) unter 2,0 °C über dem vorindustriellen Niveau halten und eine Begrenzung des Anstiegs auf 1,5 °C anstreben.
Eine Studie von 2018, die einen konstruktiven Beitrag zum Gelingen des Übereinkommens leisten möchte, nennt den Unterschied zwischen HadCRUT und BEST »erheblich«:
Wir stellen fest, dass die Trendwerte für den GMST-Verlauf 1880 – 2016 erheblich variieren, von 0,90 °C (HadCRUT4-Datensatz in Kombination mit dem IRW-Trendmodell) bis 1,12 °C (Berkeley Earth-Datensatz in Kombination mit kubischer Spline-Interpolation und φ = 0,28). Die beiden Extremwerte zeigen, dass die Spanne von Δμ2016-Werten [in unterschiedlicher Weise berechnete Temperaturtrends von 1880 bis 2016] in Abhängigkeit von den Datensätzen und Trendmodellen 0,22 °C beträgt.2
Zum Übereinkommen von Paris heißt es in der Studie:
Da große Finanzströme erforderlich sein werden, um die GMST unter diesen Zielen zu halten, ist es wichtig zu wissen, wie sich die GMST seit der vorindustriellen Zeit entwickelt hat. Das Pariser Übereinkommen ist jedoch nicht eindeutig, was die Methoden zu seiner Berechnung angeht. Soll der Trendverlauf aus GCM-Simulationen [Klimamodell-Simulationen] oder aus instrumentellen Aufzeichnungen durch (statistische) Trendmethoden abgeleitet werden? Welche Simulationen oder GMST-Datensätze sollten gewählt werden, und welche Trendmodelle? Was ist »vorindustriell« und schließlich: Sind die Pariser Ziele für die gesamte Erwärmung formuliert, sowohl von natürlichen als auch von anthropogenen, oder beziehen sie sich nur auf die vom Menschen verursachte Erwärmung? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir eine Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse durchgeführt, bei der Datensätze und Modellwahlen variiert wurden.3
Aus ihrer Analyse leitet die Studie grob zusammengefasst folgende Empfehlungen für die Politik ab: allgemeingültige Festlegung, was »vorindustriell« ist; Behandlung der verbleibenden Unsicherheiten durch Mittelung der verschiedenen globalen Temperatur-Datensätze; Mittelung verschiedener Methoden zur Trendberechnung ohne Verwendung von Klimamodellen.
Die Fragen und Empfehlungen der Studie setzen voraus, dass das Übereinkommen von Paris im Prinzip zweckmäßig ist. Um das Übereinkommen für zweckmäßig halten zu können, muss man mindestens vier Aussagen für zutreffend halten:
-
Das vorindustrielle Niveau der globalen Mitteltemperatur relativ zum heutigen ist ausreichend genau bestimmbar.
Wäre es nur auf ±1 °C bestimmbar, wüssten wir nicht, ob überhaupt eine globale Erwärmung stattgefunden hat. Beim Übereinkommen von Paris bringen bereits Unterschiede von 0,22 °C Probleme. -
Die globale Mitteltemperatur ist ein physikalisches Phänomen mit physikalischen Wirkungen.
Ohne diese Voraussetzung, die in der 4. Folge dieser Serie angesprochen wurde, wäre die globale Mitteltemperatur als Objekt verändernden Handelns ungeeignet. Handlungsziel sollte nicht die Veränderung einer Statistik mit undefinierten Bezügen zur messbaren Welt sein, sondern die Änderung konkret messbarer Temperaturen. Sollte das nicht möglich sein und hält man CO2 für ein Umweltgift, kämen Abkommen nach traditionellem Muster in Frage: die Festlegung konkreter Mengenbegrenzungen von (Netto-)Treibhausgas-Emissionen.4 -
Senkungen von (Netto-)Treibhausgas-Emissionen begrenzen den Anstieg der globalen Mitteltemperatur.
Ohne diese Voraussetzung könnte das Übereinkommen von Paris nicht den Zweck erfüllen, den es sich setzt. Das Verhältnis zwischen den Emissionen und der globalen Mitteltemperatur können wir uns dabei wahlweise als Ursache/Wirkungsverhältnis vorstellen, aber auch als nicht-zufällige statistische Entsprechung, von der nachgewiesen wurde, dass sie in beide Richtungen, Steigen und Fallen, besteht. -
Ohne Senkungen von (Netto-)Treibhausgas-Emissionen würde die globale Mitteltemperatur über ein schädliches Maß hinaus steigen.
Auch, wenn man den drei ersten Aussagen zustimmt, folgt daraus noch nicht, dass es zweckmäßig ist, die (Netto-)Treibhausgas-Emissionen zu senken. Die Zweckmäßigkeit von Emissionssenkungen setzt voraus, dass durch sie ein Schaden vermieden wird, der größer ist als der Schaden, der mit den Emissionssenkungen verbunden ist.
Schädliche Wirkungen vieler Umweltgifte sind nur durch statistische Auswertungen erkennbar. Diese stellen zum Beispiel erhöhte Erkrankungsraten oder verringerte Tierpopulationen fest. Traditionell beziehen sich auch in solchen Fällen Umweltschutzmaßnahmen auf Mengenbegrenzungen. Für diejenigen, die darüber beschließen – Regierungsvertreterinnen bei der UN oder EU oder Abgeordnete nationaler Parlamente –, sind Kosten, Nutzen und Nachteile von Mengenbegrenzungen einigermaßen einschätzbar (jedenfalls von der abstrakten Möglichkeit her). Unter politisch und wirtschaftlich günstigen Umständen wird das Ausmaß der Mengenbegrenzungen (jedenfalls von der abstrakten Möglichkeit her) von wissenschaftlichen Studien zur Schädlichkeit der betreffenden Umweltgifte beeinflusst. Diese Studien finden vor der Festlegung der Umweltschutzmaßnahmen statt und bilden deren Grundlage. Neue Erkenntnisse können neue Festlegungen nötig machen.
Das Übereinkommen von Paris funktioniert anders – wie anders, wird deutlich, wenn man es probehalber auf einen anderen Stoff bezieht. Wie wäre es zum Beispiel, Cadmium in Düngemitteln durch die Vorgabe zu begrenzen: »Senkung der Rate der Nierenerkrankungen auf 1,5 Prozent des Weltdurchschnittsniveaus von 1980″, anstatt: »Düngemittel dürfen maximal 1,5 mg Cadmium pro Kilogramm enthalten«? Dürften hohe Cadmium-Mengen in Düngemitteln belassen werden, wenn eine neue Pille die Nierenerkrankungsrate auf 0,2 Prozent purzeln lässt, aber als Nebenwirkung die Leukämierate erhöht? Wäre vertragsgemäß die Düngemittelproduktion in die Pleite zu treiben, wenn eine alkoholgetriebene Steigerung der Nierenerkrankungsraten Cadmium-Mengen von 0 mg pro Kilogramm in Düngemitteln angezeigt erscheinen lässt, die dann niemand mehr bezahlen kann?
Beim Übereinkommen von Paris können die Unterzeichnenden nicht einschätzen, worauf sie sich beziehungsweise die betroffenen Bevölkerungen einlassen. Das Übereinkommen lagert einschätzbare Maßnahmen aus dem Bereich aus, dem die Unterzeichnenden zustimmen müssen, damit sie Geltung erlangen.
Wer entscheidet über die Maßnahmen, die zur Einhaltung des Übereinkommens von Paris erforderlich sind? Sicherlich nicht nationale Parlamente oder UNO-Vollversammlungen. Die sind weder für Vertragsauslegungen noch für wissenschaftliche Studien zuständig.
Für wissenschaftliche Studien sind Wissenschaftlerinnen zuständig, die zumeist seriös und verantwortungsvoll vorgehen und deren Einkommen von Regierungspolitiken und Stiftungen abhängen. Ob und welche Studien finanziert werden und in der Politik Gehör finden, hängt von allem Möglichen ab.
Für Vertragsauslegungen zuständig sind Gerichte. Wer entscheidet nach welchen Kriterien über das Gerichtspersonal und dessen Sachkenntnisse?
Wenn Juristinnen von den Prozeduren der Ermittlung globaler Temperaturanstiege wenig genug wissen beziehungsweise ihre Kenntnisse zum Klima aus Massenmedien beziehen, halten sie das 2 °C-Ziel beziehungsweise 1,5 °C-Ziel von Paris für eine »Vorschrift«, die »präzise genug ist«, um »eine rechtliche Verbindlichkeit […] zu begründen«. So steht es in einer Ausarbeitung des Fachbereichs Europa des deutschen Bundestags von 2018. 5
Würden Juristinnen im Fall von Cadmium und »Senkung der Rate der Nierenerkrankungen auf 1,5 Prozent« genauso denken? Oder würden sie ein entsprechendes Übereinkommen als »nichtigen Vertrag« einschätzen, weil die Vertragseinhaltung praktisch nicht überprüfbar ist? Nierenerkrankungsraten können aus unterschiedlichen Gründen fallen oder steigen. Auch etablierte Klimawissenschaftlerinnen bestreiten nicht, dass es mehrjährige erhöhte Steigerungen und sogar Senkungen der globalen Mitteltemperatur geben kann, die nicht auf erhöhte oder verringerte Treibhausgas-Emissionen zurückzuführen sind.
Konkret gesehen will das Übereinkommen von Paris dafür zu sorgen, dass Globaltemperaturkurven wie die folgenden oder eine aus mehreren Kurven gemittelte Kompromisskurve nicht über gewisse Zahlenwerte hinaus steigen. Da die Kurven nicht von alleine steigen, will das Übereinkommen von Paris noch konkreter gesehen dafür zu sorgen, dass Menschen, die Globaltemperaturkurven konstruieren, nicht veranlasst werden, sie über gewisse Zahlenwerte hinaus steigen zu lassen. Günstigstenfalls lassen sich diese Menschen nur von messbaren physikalischen Umweltbedingungen veranlassen, die Kurven steigen oder sinken zu lassen, und wissen genug, um die Kurven nicht irrtümlich steigen oder sinken zu lassen.6

Das Pariser Übereinkommen ist so beschaffen, dass eine vernünftige Einschätzung seiner Zweckmäßigkeit ein Verständnis dessen voraussetzt, wie Globaltemperaturkurven zustande kommen – wenigstens, sobald man die Zweckmäßigkeit des Übereinkommens nicht aus anderen Gründen verneint. Wird die Zweckmäßigkeit des Übereinkommens zum Beispiel verneint, weil eine der vier Aussagen oben verneint wird, wäre es überflüssig, etwas über das Zustandekommen der Kurven zu wissen. So gesehen kostet es tendenziell mehr Arbeit, das Pariser Übereinkommen vernünftigerweise für zweckmäßig halten zu können, als es vernünftigerweise für unzweckmäßig halten zu können. Im ersten Fall ist außer einer Überprüfung von Voraussetzungen wie die oben genannten zusätzlich eine zumindestens grobe Kenntnis der Kurvenkonstruktion nötig.
Politisch und sozialpsychologisch laufen die Dinge anders. Die komplexen Voraussetzungen der Zweckmäßigkeit des Pariser Übereinkommens sind für viele unsichtbar und brauchen von ihnen deshalb nicht bedacht zu werden. Sie können ohne diese Mühe ihre Einschätzung des Übereinkommens als zweckmäßig für vernünftig halten, weil sie von den Voraussetzungen nichts wissen. Dies ist ein allgemeines Phänomen, der Kern aller Herrschaftsideologien. Was als richtig und normal gilt, erscheint als einfach und unmittelbar verständlich, während seine Bezweiflung ein schwieriges Unterfangen ist.
Im Folgenden möchte ich einen Beitrag zur Überprüfbarmachung von Globaltemperaturkurvenkonstruktionen durch Wissenschaftslaien leisten, damit diejenigen unter ihnen, die das Pariser Übereinkommen zweckmäßig finden, bessere Chancen haben, das Übereinkommen vernünftigerweise und nicht aus bloßer ideologischer Befangenheit heraus zweckmäßig zu finden.
Temperaturanomalien
Ein erster Schritt zur Konstruktion von Globaltemperaturkurven ist die Umrechnung von Thermometerwerten in Temperaturanomalien. Temperaturanomalien sind Abweichungen der Thermometerwerte von einem Normalwert.
In Temperaturanomalien fehlen Informationen, die in Thermometerwerten enthalten sind – unter anderem größere Teile der Temperaturschwankungen der Jahreszeiten sowie der Einfluss der Höhen, in denen Temperaturen gemessen werden. Solche Informationen loszuwerden, ist wichtig, um aus Thermometerwerten vieler Messstationen in unterschiedlichen Weltgebieten eine einzige Zahl beziehungsweise einen einzigen Punkt auf einer Kurve machen zu können.
Hier ein Beispiel mit echten Zahlen:
-
Nach Beobachtungen der Jahre 1951 bis 1980 hat sich herausgestellt, dass eine Messstation in Berlin im Juni normalerweise »durchschnittliche Tagestemperaturen« von 17,373 °C feststellt. Dies ist die Monatsmittelnormaltemperatur. Im Juni des Jahres 1981 ermittelt die Station eine »durchschnittliche Tagestemperatur« von 17,245 °C. Dies ist die Monatsmitteltemperatur. Die Monatsmittelanomalie wird wie folgt berechnet: 17,245 – 17,373 = ‑0,128 °C. Das heißt: Die Monatsmitteltemperatur im Juni 1981 ist gegenüber der Monatsmittelnormaltemperatur um 0,128 °C gesunken.
-
Eine andere Station steht in Budapest. Nach Beobachtungen der Jahre 1951 bis 1980 hat sich herausgestellt, dass die Station im Juni normalerweise »durchschnittliche Tagestemperaturen« von 20,123 °C feststellt. Im Juni des Jahres 1981 ermittelt die Station eine Monatsmitteltemperatur von 20,900 °C. Die Monatsmittelanomalie beträgt 20,900 – 20,123 = 0,777 °C. Das heißt: Die Monatsmitteltemperatur im Juni 1981 ist gegenüber der Monatsmittelnormaltemperatur um 0,777 °C gestiegen.
-
Wären die beiden Stationen die einzigen auf der Welt, könnte man sagen:
Soweit wir wissen, sind die Globaltemperaturen im Juni 1981 um (‑0,128 + 0,777)/2 = 0,3245 °C gestiegen. -
In Globaltemperaturkurven wird meistens mit Jahresmittelwerten gearbeitet. Um diese zu erzeugen, werden von Berlin die Monatsmittelanomalien sämtlicher Monate des Jahres addiert und durch 12 geteilt. Dabei kommt für 1981 eine Jahresdurchschnittsanomalie von 0,111 °C heraus. D.h. im Jahresdurchschnitt ist es 1981 im Vergleich zu den Jahren 1951 bis 1980 wärmer geworden. Bei der Station in Budapest wird ebenso verfahren. Für 1981 kommt eine Jahresdurchschnittsanomalie von 0,504 °C heraus. Auch hier ist es wärmer geworden. Gäbe es auf der Welt nur die beiden Stationen in Berlin und Budapest, bliebe kaum etwas anderes übrig, als die Globaltemperaturanomalie des Jahres 1981 so zu berechnen: (0,111 + 0,504)/2 = 0,3075 °C.
Der folgende Abschnitt erklärt, weshalb ich »durchschnittliche Tagestemperaturen« in Anführunszeichen geschrieben habe. Eigentlich hätte ich dann auch »Monatsmitteltemperaturen« und alles weitere in Anführunszeichen schreiben sollen. Aber das waren mir dann zu viele Anführunszeichen.
Monatsmitteltemperaturen und Tagestemperaturen
Monatsmitteltemperaturen landgestützter Messstationen entstehen traditionell in folgender Weise:
-
Addiere alle Tageshöchsttemperaturen (Tmax) eines Monats und teile sie durch die Anzahl der Tageshöchsttemperaturen dieses Monats. Dies ergibt die mittlere Tageshöchsttemperatur des Monats.
-
Addiere alle Tagestiefsttemperaturen (Tmin) eines Monats und teile sie durch die Anzahl der Tagestiefsttemperaturen dieses Monats. Dies ergibt die mittlere Tagestiefsttemperatur des Monats.
-
Addiere die mittlere Tageshöchsttemperatur und die mittlere Tagestiefsttemperatur des Monats und teile durch 2. Dies ergibt die Monatsmitteltemperatur (Tmn).7
Bereits im 19. Jahrhundert kam mehr und mehr ein Thermometertyp in Gebrauch, der die Anzeige einer über einen Zeitraum vieler Stunden gemessenen Höchst- und Tiefsttemperatur mechanisch »festhalten« konnte. Das folgende Bild zeigt eine ziemlich moderne Variante dieser Minimum-Maximum-Thermometer in einer Wetterstation, wie sie über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Ländern gebräuchlich waren (zum Vergrößern auf das Bild rechtsklicken und in neuer Registerkarte öffnen). Man beachte die fein gegliederte Skaleneinteilung von ganzen Grad Fahrenheit, entsprechend rund 0,55 °C.8

Mit Minimum-Maximum-Thermometern genügt es, ab und zu einen Knopf zu drücken oder das Thermometer durchzuschütteln, um die Höchst- und Tiefsttemperatur für den nächsten Zeitraum messen zu können. Probleme entstehen, wenn das zu unterschiedlichen Zeiten gemacht wird.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde beispielsweise ab einem nicht herauszufindenden Jahr bis 2001 zu drei Tageszeiten abgelesen: um 7:30, 14:30 und 21:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Nachtarbeit zum Ablesen galt als übertrieben und ist auch ungesund. Um den langen Zeitraum zwischen 21:30 und 7:30 Uhr auszugleichen, wird für manche Zwecke die Abendtemperatur doppelt gezählt: 9
Tagesmitteltemperatur = (Messung 7:30 + Messung 14:30 + 2 · Messung 21:30) /4.
Eine Studie von 2014 erklärt:
[D]ie Tmax- oder Tmin-Messungen können vom Beobachtungszeitplan abhängen, der von Land zu Land unterschiedlich sein kann. Die Definition eines Tages ist daher unterschiedlich, zum Beispiel von Mitternacht bis Mitternacht oder von Mittag bis Mittag. In Europa werden Tmin und Tmax in der Regel für 12-Stunden-Intervalle angegeben, die um 6 UTC und 18 UTC [= 7 und 19 MEZ] enden, was in vielen Regionen nicht unbedingt den tatsächlichen Tmin und Tmax entspricht, insbesondere in den Wintermonaten. Diese Diskrepanz ergibt sich daraus, dass im Winter in einigen Regionen (zum Beispiel in Europa) 6 UTC vor der klimatologisch kältesten Stunde des Sonnenaufgangs liegt, und ist zum Teil auch ein Ergebnis der synoptischen Wetterschwankungen [Schwankungen von Wetterlagen]. Diese Diskrepanz führt zu einem erheblichen Fehler bei den Schätzungen der täglichen Tmax und Tmin.10
Nach und nach kamen beziehungsweise kommen automatisierte Systeme zum Einsatz, die stündlich oder noch häufiger Messergebnisse speichern. Entsprechend genauer lassen sich Tagesmitteltemperaturen ermitteln.
Um eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Temperaturangaben der Nationen und zwischen alten und neuen Temperaturermittlungsverfahren zu wahren, sollen nach den aktuellen Standards der WMO Tagesmitteltemperaturen nach dem oben beschriebenen traditionellen Vorgehen berechnet werden. Als Tagestiefsttemperatur Tmin gilt dabei die niedrigste Temperatur, die im Verlauf von 12 Stunden gemessen wird – ob nun nur ein Mal oder oft gemessen wurde. Als Tageshöchsttemperatur Tmax gilt entsprechend die höchste Temperatur, die im Verlauf der anschließenden 12 Stunden gemessen wird.
Bei mehr als zwei Messungen täglich werden durch dieses Verfahren alle Messwerte bis auf zwei ignoriert. Eigentlich könnte eine Mittelwertbildung unter Einbeziehung sämtlicher Messwerte die Tagesmitteltemperaturen besser repräsentieren.
Eine Studie von 2019 untersuchte die Auswirkungen unterschiedlicher Tagesmittelwertbildungen auf die Jahresmitteltemperaturen in China. Sie verglich folgende Tagesmittelwerte:
-
Tmn
nach WMO-Standard aus Tmin und Tmax berechnet (Max-Min-Mittelwert-Methode) -
T4
arithmetisch gemittelt aus vier gleichmäßig über den Tag verteilten Messungen (um 2:00, 8:00, 14:00 und 20:00 Uhr Pekinger Zeit) und -
T24
arithmetisch gemittelt aus stündlichen Messungen.
Aus diesen Tagesmitteltemperaturen entstehen durch arithmetische Mittelung jeweilige Monatsmitteltemperaturen. Aus den Monatsmitteltemperaturen wiederum entstehen Jahresmitteltemperaturen, indem alle Monatsmitteltemperaturen addiert und durch 12 geteilt werden. In der Studie heißt es:
Die systematische Abweichung der geschätzten Durchschnittstemperatur unter Verwendung täglicher Tmax- und Tmin-Aufzeichnungen im Vergleich zur Standarddurchschnittstemperatur von vier zeitlich gleich weit auseinander liegenden Messungen und ihre Auswirkung auf die Trendberechnung der langfristigen Temperaturveränderung sind nicht gut verstanden worden. […] Die Ergebnisse zeigten, dass die positive Abweichung der Jahresmitteltemperaturen groß war und im nationalen Durchschnitt 0,588 °C erreichte […] Darüber hinaus zeigte die Abweichung in den letzten 50 Jahren einen signifikanten Aufwärtstrend, […] der etwa 12 Prozent der gesamten Erwärmung ausmachte, die anhand der Daten des Beobachtungsnetzes geschätzt wurde; […] der bemerkenswerteste Anstieg der Abweichung trat nach den frühen 1990er Jahren auf. […]
In klimatologischen Studien und Klimavorhersagen führt die Verwendung von Tmn im Allgemeinen zu einer höheren Tages- und Monatsmitteltemperatur als T24 oder T4, […] wahrscheinlich auch in anderen subkontinentalen Regionen der Welt. In einigen Regionen des Landes erreicht die Abweichung in bestimmten Jahreszeiten sogar 1,00 °C. […] Wenn dieses Problem auf der globalen Landoberfläche nicht zu vernachlässigen ist oder die großen Abweichungen bei den Durchschnittstemperaturen und den linearen Trends, die mit der Max-Min-Mittelwert-Methode berechnet werden, in den aktuellen globalen Lufttemperaturdatensätzen für die Landoberfläche auftreten, dann besteht die dringende Notwendigkeit, die täglichen und monatlichen Beobachtungsdaten und die darauf basierenden Schätzungen der Temperaturtrends anzupassen und auch die Vereinbarung über die Übermittlung von Daten durch die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) für den zukünftigen Betrieb und die Erforschung von Klima und Klimawandel zu überarbeiten.11
Referenzperioden
Nach den Standards der WMO wird die Monatsmittelnormaltemperatur bei landgestützten Messstationen idealerweise wie folgt berechnet:
-
Bilde aus den »durchschnittlichen Tagestemperaturen« jeden Monats derselben Messstation ein arithmetisches Mittel. Dies ergibt eine Januar-Monatsmitteltemperatur, Februar-Monatsmitteltemperatur, März- Monatsmitteltemperatur … dieser Messstation im betreffenden Jahr.
-
Bilde aus 30 aufeinander folgenden Januar- Monatsmitteltemperaturen dieser Messstation ein arithmetisches Mittel. Dies ergibt die Januar-Monatsmittelnormaltemperatur. Bilde aus 30 aufeinander folgenden Februar- Monatsmitteltemperaturen dieser Messstation einen 30-Jahre-Februar-Mittelwert. Und so weiter …12
Damit eine Globaltemperaturkurve nicht von rechnerischen Störungen beeinträchtigt wird, muss die 30-Jahres-Periode bei allen Messstationen, deren Daten in die Kurve einfließen, dieselbe sein.
Viele Messstationen haben keine 30 Jahre lang aufeinander folgenden Monatsmitteltemperaturen zu bieten, beispielsweise, weil sie nur 10 Jahre lang betrieben wurden oder weil zwischendurch der Betrieb ruhte. In solchen Fällen entscheiden zuständige Wissenschaftlerinnen bei der NOAA, CRU usw. unterschiedlich, wie am besten vorzugehen ist. Je nachdem schätzen sie die Monatsmittelnormaltemperaturen, indem sie in komplizierten statistischen Berechnungen Messwerte mehr oder weniger entfernter Stationen (bis 1200 km) zu Hilfe nehmen, oder sie ignorieren bei der Berechnung der globalen Mitteltemperatur die betreffende Station.
Das Ausmaß der Problematik ungenügender Stationsdaten zur Ermittlung von Monatsmittelnormaltemperaturen ist ein wichtiges Kriterium bei der Festlegung der 30-Jahres-Periode. Je weniger ununterbrochene Temperaturmesswertketten in einer Periode vorliegen, desto mehr muss mathematisch-statistisch an den Messdaten herumgedoktert werden. In den globalen Datensätzen wurden die Perioden unterschiedlich festgelegt. Zur Zeit sind es 1961 – 1990 bei HadCRUT, 1971 – 2000 bei NOAA Global Temp und 1951 – 1980 bei GISTEMP und BEST.
Hauptsächlich bewirken die unterschiedlichen Referenzperioden, dass die Globaltemperaturkurven als Ganzes auf der y‑Achse nach oben oder unten rutschen. Im Bild oben, bei dem die Referenzperioden der Datensätze auf 1961 – 1990 vereinheitlicht sind, liegen die Kurven dadurch näher beieinander als im letzten Bild der 5. Folge, bei dem die Referenzperioden nicht vereinheitlicht sind.
Unterschiedliche Referenzperioden führen vor dem Hintergrund längerfristig einseitiger Temperaturveränderungen bei Extremwert-Trendberechnungen zu Verzerrungen von bis zu 50 Prozent, wie Wissenschaftler des Hadley Centre in einem Aufsatz von 2022 bemerken:
Wir haben gezeigt, dass bei einer Erwärmung des Klimas lineare Trends, die über denselben Zeitraum mit denselben zugrunde liegenden Daten berechnet wurden, erheblich voneinander abweichen, wenn zwei verschiedene 30-jährige Referenzperioden (1961 – 1990 und 1981 – 2010) verwendet werden.13
Wetterballons
Temperaturanomalien lassen sich auch ohne Normalwertberechnung beziehungsweise Referenzperioden bilden. Unter anderem gibt es eine Methode namens FD (First Difference). 14
Diese Methode geht im Prinzip so: Ziehe die aktuelle Monatsmitteltemperatur einer Station von der Monatsmitteltemperatur des Vorjahres dieser Station ab und addiere die Monatsmittelanomalie des Vorjahresmonats dieser Station, zum Beispiel:
[Monatsmittelanomalie Juni 1890] = [Monatsmitteltemperatur Juni 1890] – [Monatsmitteltemperatur Juni 1889] + [Monatsmittelanomalie Juni 1889].
Im allerersten Monat gibt es keine Monatsmittelanomalie. Hier liegt der Startpunkt der Anomaliekette. Er wird auf 0 gesetzt. Der Jahresmittelwert ist wie bei der Normalwert-Methode der arithmetische Mittelwert aller Monatsmittelanomalien.
Auf der Suche nach praktischen Anwendungen der FD-Methode stoße ich auf Wetterballons, deren Daten mit dieser Methode ausgewertet werden. Wetterballon-Daten eignen sich ab etwa Ende der 1950er Jahre zur unabhängigen Kontrolle der üblichen Globaltemperaturkurven. Wetterballon-Daten vor dieser Zeit gelten als zu spärlich und zu unsicher für diesen Zweck.
Im Vergleich zu landgestützten Wetterstationen gibt es relativ wenige Wetterballons, und ihre Daten haben mehr zeitliche Unterbrechungen. Auch hat man bei Instrumentenwechseln zu wenig für kontrollierbare Übergänge gesorgt, zum Beispiel durch gleichzeitige Nutzung alter und neuer Instrumente während einer Übergangszeit. Um im Rahmen der FD-Methode die Unterbrechungen – fehlende Monatsmittelwerte und Temperatursprünge durch neue Instrumente – zu überbrücken, werden komplizierte statistische Berechnungen gemacht.15
Wetterballons haben gegenüber landgestützten Wetterstationen den großen Vorteil, dass sie Temperaturen in unterschiedlichen Höhen messen können.
Je höher es in der Atmosphäre hinauf geht, desto niedriger wird der Luftdruck. Temperatur-Messergebnisse von Wetterballons sind dazu passend meist nach Millibar (mb) oder, was dasselbe ist, Hektopascal (hPA) Luftdruck gegliedert. Ab einer gewissen Höhe platzen die armen Ballons aufgrund des niedrigen Luftdrucks. Bis es soweit ist, übermitteln sie ihre Messergebnisse durch kleine Funkgeräte: Radiosonden.
Die folgende Grafik zeigt Globaltemperaturkurven von Wetterballons ab 1958 – grob geschätze Höhenangaben habe ich hinzugefügt16:

Nach den Ballon-Kurven zu urteilen, wurde es in größeren Höhen kälter und in Bodennähe wärmer.
Atmosphäre
Die Globaltemperaturkurven, mit denen uns Massenmedien und Schulbücher beglücken, verwenden Werte, die sich über den Landflächen der Erde auf etwa 2 Meter über dem Boden beziehen. Der Boden wiederum kann in unterschiedlichen Höhen relativ zum Meeresspiegel liegen, auf einem Berg oder in einem Tal, an der Küste oder auf einem Plateau …
Die überwältigende Mehrheit der Wetterstationen der Welt befindet sich in einer Höhe unterhalb von 1000 Metern.17 Im Vergleich zur Atmosphäre sieht das wie der orangene Balken ganz unten im folgenden Bild aus:

Globaltemperaturen »bodennahe Globaltemperaturen« oder »globale mittlere Oberflächentemperaturen« zu nennen, ist wohl keine übertriebene Pingeligkeit – falls die Bezeichnung »Temperatur« für gemittelte Temperaturdifferenzen von mathematisch aufgepeppten Mittelwerten, die nicht unbedingt welche sind, nicht an Pingeligkeiten scheitert.
Wassertemperaturen
Da rund 71 Prozent der Erdoberfläche von Ozeanen bedeckt ist, müssen zur Ermittlung der bodennahen globalen Temperaturentwicklung die Messdaten landgestützter Stationen durch Messdaten ergänzt werden, die sich auf Meeresgebiete beziehen.
Wie das geschieht und wie Luft- und Wassertemperaturen zu bodennahen globalen Temperaturanomalien vermixt werden, wird Thema der nächsten Folge sein.
Wer sich inzwischen mit den Thermometerdaten von Berlin, Budapest und anderen europäischen Städten seit 1780 oder mit Wetterballons beschäftigen möchte oder eine arme Teufelin ist, die Tabellenkalkulation lernen muss, kann hier Zahlenmaterial herunterladen:
-
DeBilt_Berlin_Prag_Budapest_Wien (LibreOffice und OpenOffice)
-
Wetterballons (LibreOffice und OpenOffice)
-
Wetterballons (Excel).
Verweise
1 Hompepage von GloSAT (gesehen 3.10.2022).
Alle Zitate aus englischsprachigen Quellen sind unautorisiert übersetzt. Text in eckigen Klammern wird zu Erklärungszwecken hinzugefügt.
2 H Visser, S Dangendorf et al.: Signal detection in global mean temperatures after »Paris«: an uncertainty and sensitivity analysis. Clim. Past, 14, 1 – 17, 2018, DOI 10.5194/cp-14 – 1‑2018, S. 11
3 H Visser, S Dangendorf et al.: Signal detection in global mean temperatures after »Paris«: an uncertainty and sensitivity analysis. Clim. Past, 14, 1 – 17, 2018, DOI 10.5194/cp-14 – 1‑2018, Abstract
4 Siehe vergleichsweise zum Beispiel das 1987 vereinbarte Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen,
James Hansen, der ehemalige GISS-Direktor, der sich 1988 auf einer US-Senatsausschusssitzung den Schweiß abwischte (5. Folge), nannte das Pariser Übereinkommen aufgrund der fehlenden Mengenbegrenzungen »bullshit« und »fraud«/Betrug (Oliver Milman: James Hansen, father of climate change awareness, calls Paris talks ›a fraud‹. The Guardian 12.12.2015)
5 Rechtsverbindlichkeit des Übereinkommens von Paris, Aktenzeichen PE6-3000 – 105/18
6 Grafik aus R Rohde, Z Hausfather: The Berkeley Earth Land/Ocean Temperature Record. December 2020, Earth System Science Data 12(4):3469 – 3479, DOI:10.5194/essd-12 – 3469-2020, Lizenz: CC By. Jährliche Anomalien relativ zur Referenzperiode 1961 – 1990. Die erfassten Erdgebiete wurden wohl nicht auf eine gemeinsame Schnittmenge angeglichen. Der graue Bereich »Berkeley Uncertainty« gibt einen von Berkeley Earth berechneten Unsicherheitsbereich an – so etwas wie ein 95 Prozent-Konfidenzintervall. Cowtan und Way kommen in einer späteren Folge noch vor.
7 Siehe zum Beispiel Rechentafel der US-Landwirtschaftsbehörde. Rechnerisch käme dasselbe heraus, wenn man sämtliche Tageshöchst- und Tagestiefsttemperaturen addiert und durch deren Gesamtanzahl teilt – falls für alle Tage des Monats Tageshöchst- und Tagestiefsttemperaturen vorliegen. Fehlt aber beispielsweise eine Tagestiefsttemperatur, weil der Thermometerablesemensch auf einer Hochzeitsfeier betrunken unter dem Tisch liegt, würde bei dieser Rechenmethode die Monatsmitteltemperatur Schlagseite bekommen, weil mehr Tageshöchsttemperaturen als Tagestiefsttemperaturen in den Mittelwert einflössen.
9 Deutscher Wetterdienst: Informationen zu den Tages- und Monatswerten (gesehen 9.9.2022)
10 K Wang: Sampling Biases in Datasets of Historical Mean Air Temperature over Land. Scientific Reports 4:4637, April 2014, DOI 10.1038/srep04637
11 Y Liu, G Ren et al.: A Significant Bias of Tmax and Tmin Average Temperature and Its Trend. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Volume 58/Issue 10, 1 Oct 2019, DOI 10.1175/JAMC-D-19 – 0001.1, pp. 2235 – 2246
12 WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals, WMO-No. 1203, 2017. Siehe auch A Arguez, R S Vose: The Definition of the Standard WMO Climate Normal: The Key to Deriving Alternative Climate Normals. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 92, No. 6 (JUNE 2011), pp. 699 – 704
13 R J H Dunn, C P Morice: On the effect of reference periods on trends in percentile-based extreme temperature indices. Environ. Res. Lett. 17 (2022) 034026. DOI 10.1088/1748 – 9326/ac52c8
14 Siehe dazu zum Beispiel T C Peterson, T R Kart et al.: First difference method: Maximizing station density for the calculation of long-term global temperature change. JGR Atmospheres Vol. 103, Issue D20, 27 October 1998, pp. 25967 – 25974, DOI 10.1029/98JD01168, sowie Blog Statistics and Other Things: Combining Stations (Plan B), Februar 2010, und Diskussion zum Zusammenfügen von Temperaturmessreihen im Blog the Air Vent: Anomaly Aversion (März 2010 bis Dezember 2016).
15 Siehe zum Beispiel F Madonna, E Tramutola et al.: The New Radiosounding HARMonization (RHARM) Data Set of Homogenized Radiosounding Temperature, Humidity, and Wind Profiles With Uncertainties. JGR Atmospheres, Vol. 127, Issue 2, 27 January 2022, DOI 10.1029/2021JD035220
16 Datenquelle: NOAA/NCEI RATPAC – https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ratpac/ratpac‑a/RATPAC-A-annual-levels.txt.zip. Die Höhenangaben sind nur sehr grob geschätzt mit Hilfe des Atmospheric Properties Calculator. RATPAC steht für Radiosonde Atmospheric Temperature Products for Assessing Climate (Radiosonden-Atmosphärentemperaturprodukte zur Beurteilung des Klimas). Die RATPAC-»Produkte« sind Zahlen-Zusammenstellungen der NOAA/NCEI, die mit Hilfe von 85 auf der Welt ganz gut verteilten Wetterballon-Stationen entstehen (siehe Bild bei Euan Mearns: RATPAC – an initial look at the Global Balloon Radiosonde Temperature Series. Energy Matters 1.2.2016). Mehr über RATPAC bei der NOAA/NCEI und in M Free, DJ Seidel et al.: Radiosonde Atmospheric Temperature Products for Assessing Climate (RATPAC): A new data set of large-area anomaly time series. J. Geophys. Res., 110, D22101, 16 November 2005, DOI 10.1029/2005JD006169
Aktuelle Karten sämtlicher Wetterballonstationen bei Github – radiosonde launch sites.
17 Siehe zum Beispiel J M Thornton, N Pepin et al.: Coverage of In Situ Climatological Observations in the World’s Mountains. Frontiers in Climate 4:814181, 26 April 2022, DOI 10.3389/fclim.2022.814181. Vor 12 Jahren hatten sich mal die Mühe einer Auszählung der GHCN-Stationen nach Höhen gemacht: S Mosher, Z Hausfather, N Stokes: The Big Valley: Altitude Bias in GHCN. WUWT 19.8.2010
Bild: M. Bogatyrev »Heißer Sommer« 1956 (https://t.me/SocialRealm)


