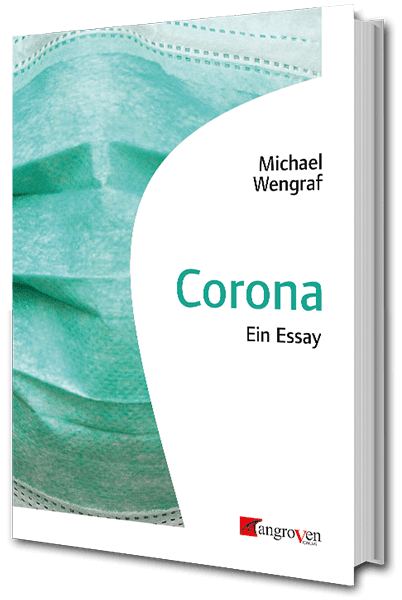
Bleiben wir aber beim Problem der Sichtweise, beziehungsweise kehren dorthin zurück. Plassmanns Forderung eines umfassenden Herangehens knüpft dort an, wo bereits Ernst Bloch Wegmarken gesetzt hatte, beim ganzen Menschen als Objekt (-Subjekt) der Heilung. Bloch meinte über die Medizin in der bürgerlichen Gesellschaft:
Vom lebendigen ganzen Leidträger wird weggesehen, besonders aber von den Umständen, worin er sich befindet. Von daher die Überschätzung der Bazillen [und aktuell Viren/M.W.], als der einzigen Seuchenerreger; die Mikrobe verdeckte vor allem andere Begleiterscheinungen der Krankheit, schlechtes Milieu und dergleichen, so enthob sie von der Pflicht, auch dort nach Ursachen zu suchen.1
Bloch meint dann diesbezüglich: »Bloßer mechanistischer Pflasterkasten, ohne Primat des sozialen Milieus […].»2 Besser kann auch die heutige Ausgangslage nicht auf den Punkt gebracht werden.
Bloch spricht damit die Konzentration auf jenen »kleinen Teil des Menschen« an, den Plassmann wohl in Bezug auf die Beschränktheiten der Drosten, Lauterbachs und Brauns im Blick hatte. Der Mensch in seiner sozial-ökonomischen beziehungsweise gesellschaftlichen Ganzheitlichkeit ist in gegenwärtiger Gesellschaft jedoch aus Prinzip wohlweislich nicht Objekt-Subjekt kapitalistischer Gesundheitspolitik. Noch ein Dictum Blochs hat für die heutigen Verhältnisse einige Relevanz: »Und Gesundheit wiederherzustellen, heiße in Wahrheit: den Kranken zu jener Art von Gesundheit zu bringen, die in der jeweiligen Gesellschaft die anerkannte ist […].»3 Anerkannte Gesundheit besteht gegenwärtig allerdings nicht darin, frei von Sympthomen und Einschränkungen zu sein, sondern sich gänzlich frei von Corona-Viren zu präsentieren. Und nur das. Ein Zustand, der unter gegebenen Zuständen nur schwerlich zu erreichen ist und deshalb »ewiges Ziel« bleiben muss.
Die ganzheitliche Betrachtung des Menschen in der Wissenschaft, in der Medizin ebenso wie in der Philosophie, lässt sich zurückverfolgen bis in die Antike.4
Die Philosophie lehrt jetzt den Arzt die Kunst des methodischen Schließens, wie man eine Wissenschaft auf Erfahrung logisch aufbaut, und sie gibt dem Objekt des ärztlichen Forschens, dem Menschen, als universalem Hintergrund die Lehre von der Gesamtheit des organischen Lebens, deren eigentlicher Schöpfer Aristoteles ist.5
Dementsprechend wandelte sich das substantialistisch aufgefasste Prinzip des organischen Ganzen in eine »Lehre von der Seele als einer den Körper von innen heraus zusammenhaltenden Entität«.6 Schon der junge Marx reflektierte in den Vorarbeiten zu seiner Dissertation über die gestörte Einheit dieser ganzheitlichen Seele, der Diskrepanz zwischen Körper und Geist. Er kam darin zum Schluss, dass Krankheit eine Entfremdung zwischen Körper und Geist darstelle und meinte nach seiner Auseinandersetzung mit den Theorien von Epikur und Plutarch: »Die Gesundheit, als der identische Zustand, vergisst sich von selbst, da ist gar keine Beschäftigung mit dem Körper; diese Differenz beginnt erst in der Krankheit.«
Die Krankheit in den Mittelpunkt zu rücken schafft rundum Übel. Das ist eine Sichtweise, die der Herkunft der europäischen Heilkunde aus der griechischen Stoa entspricht. »Diese Schule vertraute dem natürlichen Lauf der Dinge, wollte ihn nirgend sprengen, überall ihm gemäß werden.»7 Krankheit ist nach stoischer Auffassung eben nichts anderes als Störung des Gleichgewichts, das auf den »ganzen Menschen« zielte. Erst wenn dessen soziale und gesellschaftliche Ausgewogenheit ge- oder gar zerstört wird, kommt es zu einer umfassenden krisenhaften Zuspitzung. Nichts Anderes aber als die Destruktion unserer gewohnten Lebensbedingungen geschieht heute durch die aktuelle Corona-Politik. Due vernichtet mehr als nur individuelle Gesundheit, sie zerstört rundum das gesellschaftliche Wohlsein: Die Krankheit wird in den Mittelpunkt gerückt.
Es geht also nach solch einem Ansatz, wie dem aristotelischen oder stoischen, eben nicht um den »kleinen Teil des Menschen«, den die Virologie oder Bakteriologie alleine abdeckt, sondern, wie eben seit alters her bekannt, um eine Sichtweise, die weit darüber hinausgeht. Die Gesamtheit seines organischen Lebens ist – auf den Menschen bezogen – eben abhängig von der Gesamtheit seiner Lebensumstände. Daraus ergibt sich aus medizinischer Sicht eine medizinische Totalität in der Betrachtung des Patienten, wie sie Plassmann einfordert, und aus menschlicher Sicht eine übergeordnete menschliche Totalität. Robert Koch vertrat im Gegensatz zu dem nach ihm benannten Institut noch eine Ansicht, die den Menschen als solchen auf das Podest hob: »Das Bakterium ist nichts, der Wirt alles!« Heute sei es umgekehrt, meint Michael Ewert: »Ein Virus hat das ganze Denken verseucht. Was der Stärkung des Immunsystems dienen könnte, ist Missachtung, Geringschätzung oder sogar der Zerstörung preisgegeben.»8
Dieser Text ist ein Auszug aus Michael Wengrafs Essay Corona, erschienen im Herbst 2020 im Mangroven Verlag: Michael Wengraf, Corona. Ein Essay, Mangroven Verlag, Kassel, 2020, 15,00 €. Dort liegen vom selben Autor noch Monographien über die Rechte Revolution, die Genese der europäischen Universität und über die Frankfurter Schule vor.
Verweise
1 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1985, 544.
2 Ebenda.
3 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1985, 539.
4 Hans Heinz Holz weist auf diese Tatsache in seiner »Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart« (Darmstadt 2011) eindrücklich hin. Hier Bd. 1 Antike, 433.
5 Werner Jäger, Diokle von Karystos, Berlin 1963, 222.
6 Hans Heinz Holz, Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Darmstadt 2011, Bd. 1 Antike, 433.
7 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1985, 537.
8 Michael Ewert, Die wahre Querfront, auf: https://www.rubikon.news/artikel/die-wahre-querfront (10.10.2020).


